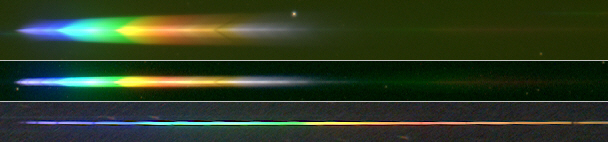
Erfahrungen mit dem Star Analyser und dem Samyang 135 mm, f/2 Objektiv
Als Kamera diente die ASI 294 MC Pro.
1. Filterschublade oder Objektivgitter?
Angefangen habe
ich mit dem SA200 in der Filterschublade, 2,5 cm vor dem Sensor.
Das obere Bild zeigt ein Spektrum von Rigel mit starken
Farbfehlern bei Offenblende.
Die Mittellinie des Spektrums ist aber durchaus brauchbar.
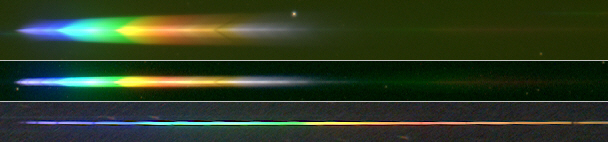
Das mittlere Bild
zeigt ein Spektrum von Wega mit dem SA200 in der Filterschublade
und dem Objektiv abgeblendet auf f/4.
Das untere Bild zeigt ein Spektrum von Wega mit dem SA100 vor dem
Objektiv bei Offenblende.
Trotz des Wechsels
von SA200 auf SA100 ist das Spektrum wegen des viel größeren
Abstands zum Sensor etwa dreimal länger als vorher.
Das Spektrum ist nun auch deutlich farbreiner und schärfer.
2. Die Orientierung des Gitters
Je farbreiner und schärfer das Spektrum ist, desto wichtiger wird es das Spektrum so waagerecht wie möglich auf dem Sensor zu plazieren.

Wegaspektrum mit SA200 als Objektivgitter an f = 35 mm, zweifach
vergrößert
Der Drehwinkel
beträgt hier nur etwa acht Grad, aber es sind zahlreiche
"Treppenstufen" sichtbar, die bei der Drehung in die
Horizontale Artefakte erzeugen.
Selbst bei einem Drehwinkel von nur einem Grad wird ein 600 Pixel
langes Spektrum um 10 Pixel an einem Ende nach oben oder unten
verschoben und
es entstehen 10 Treppenstufen.
Das Gewinde der Star Analyser hat nur einen Durchmesser von etwa
25 mm. Ein Grad Drehung bedeutet da eine Drehung des Gewindes um
nur 0,2 mm!
3. Debayern
Alle Bilder wurden
im Superpixel-Modus debayert. Dabei werden die vier Pixel der
Bayermatrix zu einem RGB-Pixel zusammengefaßt und die Auflösung
sinkt auf die Hälfte.
4. Instrumental Response
Der variable Teil
des "Instrumental Response" wird durch den wechselnden
Zustand der Atmosphäre verursacht. Der Himmelshintergrund wird
auf die
Spektren addiert und verfälscht sie. Das kann durch eine
einfache Subtraktion korrigiert werden. Aufwendiger ist die
Berücksichtigung der variablen
Extinktion.
Hier "Relative Flux Calibration
of Low Resolution Spectra (“Correcting for Instrument
Response”)" wird das Problem ausführlich beschrieben
und eine
Lösung gezeigt: Wenn man außer dem Zielobjekt unter denselben
Bedingungen einen Stern mit bekanntem Referenzspektrum aufnimmt
und daraus
den "Response" bestimmt, dann kann man das Spektrum des
Zielobjekts durch diesen "Response" dividieren. Damit
sind dann die atmosphärischen
Einflüsse auf mein Spektrum (so gut es geht) beseitigt.
5. Das Spektrum 2. Ordnung
Es zeigte sich, dass die Lage des
Spektrums 2. Ordnung davon abhängt, wo das Spektrum 1. Ordnung
beginnt. In dem verlinkten Beispiel beginnt das
Spektrum 1. Ordnung von beta Lyrae bei etwa 3700 Å und damit das
Spektrum 2. Ordnung bei etwa 7400 Å.